Die Wochen des Wartens auf Weihnachten gehören besonders mit Kindern zu den schönsten des Jahres. Kinder begeistern sich für die vielen Details des Festes: Das Plätzchenbacken, den Baum aussuchen und schmücken, die Adventskerzen anzünden, einen Teller für den Nikolaus vorbereiten, Weihnachtslieder singen. Kinder können noch warten, sie genießen die Vorfreude, auch wenn sie immer wieder ungeduldig fragen, wann denn nun endlich das Christkind kommt. Weihnachten ist Vorfreude pur, eben weil sie es kaum erwarten können. Wir Erwachsenen nehmen heute die Adventszeit als vorgezogene Weihnachtszeit und eilen von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Das nimmt nicht nur uns die Ruhe, sondern gibt auch den Kindern das falsche Signal: Wenn wir uns aber die Zeit nehmen, mit ihnen gemeinsam Gebäck zu backen, und der Weg das Ziel ist, wir also den Moment genießen, und weniger darauf schauen, ob alles perfekt ist, dann entsteht etwas Wertvolles. Selbstgebackene Plätzchen schmecken am besten und die leuchtenden Augen der Kinder machen uns das Herz voll.

Dass Maria auf ihr Jesuskind wartet, können Kinder gut nachvollziehen. Viele wünschen sich noch ein Geschwisterchen und können sich in das Warten und Hoffen hineinversetzen. Kinder haben häufig eine natürliche Offenheit für das Spirituelle. Weihnachten mit dem Jesuskind gibt ihnen das Gefühl, dass sie behütet sind, dass Gott und die Engel über sie wachen, und sie fühlen sich dadurch geliebt und angenommen. Dieses Vertrauen gibt ihnen Halt und vermittelt ihnen, dass sie in dieser Welt willkommen sind. Für dieses Gefühl nehmen sie das Warten gern in Kauf. Das ist zwar nicht die christliche, angstvolle Botschaft, die ja meint, die „Welt ging verloren“ und wir müssten erlöst werden. Der Kinderglaube hält es mehr mit der altbiblischen Botschaft der Liebe Gottes, die alle Religionen teilen.
Immerhin spiegelt das Warten auf die Parusie, auf die Wiederkehr Gottes, die im Advent symbolisch inszeniert wird, bis heute eine erwartungsfrohe Haltung wider: In den Psalmen heißt es: „Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten.“ Damals bedeutete Warten einerseits Unterordnung, doch gleichzeitig war es Ausdruck der Hoffnung auf das Gute, das aus einer höheren Macht hervorgehen sollte – ein Vertrauen darauf, dass nicht alles in der eigenen Kontrolle liegt. Demgegenüber steht der moderne Glaube an die unbegrenzte Machbarkeit: sei es in Form technischer Perfektion oder visionärer Ideen wie der „Singularität“, die eine Welt ohne Warten und Geduld verspricht.
Paradoxerweise führt dieser Fortschrittsglaube des „anything goes“ oft zu mehr Unglück als einst die mittelalterliche Vertröstung. Früher wartete man auf besseres Wetter, das Ende von Schmerzen oder das Schweigen der Waffen – ohne zu wissen, ob diese Hoffnungen je erfüllt würden. Heute hingegen leben wir in einer Zeit, in der jeder sein eigenes Glück täglich neu erschaffen soll. Wer nicht reich, glücklich, fit und frisch verliebt ist, gilt schnell als Versager. Und doch hoffen wir trotz aller technologischen Fortschritte immer noch wie früher – wenn auch auf einer anderen Ebene – auf Frieden, Glück und Heilung. Was hat sich im Kern wirklich verändert? Können wir heute tatsächlich selbst alles sofort zum Guten wenden? Dieselbe Regierung, die nicht einmal einen verfassungskonformen Haushalt zustande bringt, behauptet ernsthaft, das Weltklima regulieren zu können. Die Hybris, alles beherrschen zu können, durchzieht dabei sowohl die Politik als auch die Digitalkonzerne aus Kalifornien – und beide haben keine Zeit. Deren vollmundige Versprechen scheinen oft mehr Probleme zu schaffen als zu lösen – zuletzt verbot Australien Smartphones für Jugendliche wegen deren negativen Folgen für Geist und Psyche. Was uns vor die Frage stellt, ob wir wirklich so weit entfernt sind von den Hoffnungen und Ängsten früherer Zeiten – nur mit anderen Mitteln und einer ähnlichen Sehnsucht nach Erlösung. Wenn das so ist, was hat uns dann aber die rasende Ungeduld seit der Moderne gebracht?

Wir Erwachsenen haben heute das Warten verlernt. Es ist beinahe lustig, dass die Zeit des Wartens, der Advent, sich zur hektischsten Zeit des Jahres verwandelte, und die „Stille Nacht“ in eine „eilige Nacht“: „Alle rasen, keiner wacht / über Straßen im Lichtermeer / einkaufsgehetzt, die Tüten schwer“. Kinder brauchen die wahnsinnige Kommerzialisierung übrigens nicht, die wir inzwischen aus Weihnachten gemacht haben, auch wenn sie sich natürlich in erster Linie auf die Geschenke freuen. Sie waren früher mit viel weniger zufrieden und wären es heute genauso.
Der Zeitforscher Karlheinz Geißler erinnert daran, dass in fast allen Hochkulturen »Geduld, Gelassenheit, Beharrlichkeit und auch Langsamkeit, ein Zeichen der Würde, der Klugheit und der Selbstachtung« waren. Wenn das stimmt, dann haben wir heute generell an Würde, Klugheit und Selbstachtung verloren. Keine so gute Zeitdiagnose, oder?
Wir meinen, dass wir uns Warten nicht mehr leisten können. Wenn nicht sofort etwas gegen den Klimawandel, den Rückstand bei der Digitalisierung usw. – da läßt sich beliebig viel einsetzen – gemacht wird, dann geht die Welt unter. Fridays for Futures Frontfrau Greta musste ihren Twitterpost schon löschen, weil das Datum des von ihr vorhergesagten Weltuntergangs folgenlos verstrichen war, wie bei den Zeugen Jehovas.
Andererseits ist klar, dass Warten nicht bedeuten kann, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen und untätig zu bleiben. Schon im schicksalsgläubigeren und geduldigeren Mittelalter wussten die Menschen das. Ein Bauer wartete auf eine gute Ernte. Doch diese hängt nicht allein von seiner sorgfältigen und ehrlichen Arbeit ab. Sein Warten ist kein müßiges Abwarten, sondern aktives Handeln. Sein Warten ist Arbeit, und seine Arbeit ist Warten. Eine Ernte muss reifen, ein Kind muss erwachsen werden, und auch eine Entscheidung will wohlüberlegt sein. Alles hat seine Zeit.
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit …“
Dieser unzeitgemäße Spruch stammt aus dem Buch der Prediger (Kohelet) im Alten Testament. Dort heißt es in Kapitel 3 (1–8): „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit …“
Dieser Text beschreibt, dass es für alles eine passende Zeit gibt und dass der Mensch diese nicht vollständig kontrollieren kann. Die Natur folgt ihrem Lauf, das Leben bewegt sich in Zyklen, die Jahreszeiten wie die Konjunkturzyklen, und Zustände wechseln sich ab. Der Mensch tut gut daran, im Einklang mit der Natur zu leben. Die antiken Stoiker verbanden das Prinzip des „Alles hat seine Zeit“ mit der Gelassenheit (ataraxia). Wenn wir den Lauf der Natur durch Technik beschleunigen, kann das klappen, aber auch zu ungeahnten Nebenfolgen führen. Hat nicht die rasche Industrialisierung und der damit verbundene CO2-Ausstoß zu einer beschleunigten globalen Erwärmung geführt, und rennen wir jetzt nicht wie die Zauberlehrlinge der Entwicklung hinterher? Die Atomkraft versprach unermessliche Energie, aber unser Energiehunger ist größer als je zuvor und wir fürchten das nukleare Wettrüsten und den Atomkrieg. Was haben wir also unterm Strich gewonnen? Viele moderne Versprechen haben sich in ihr Gegenteil verkehrt: Statt mehr Zeit zu haben, hetzen wir, und statt selbstbestimmt über unsere Zeit zu verfügen, diktieren uns andere die Agenda. Wir haben das Warten verlernt. Indem wir die Wartezeit totschlagen, schlagen wir uns am Ende selber tot – wir schätzen den Weg nicht mehr, sondern überschätzen das Ziel (das vielleicht enttäuschender ist als der Weg dahin).
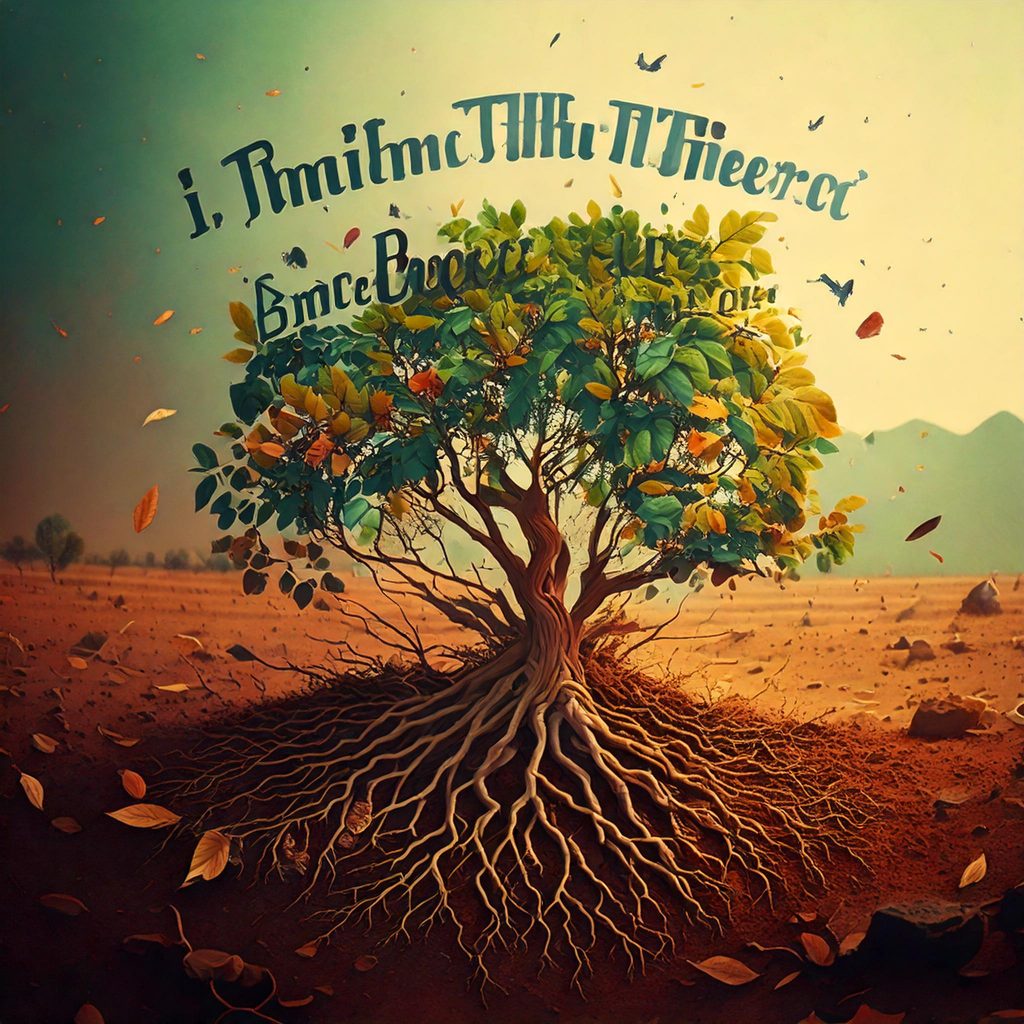
Die heutige Verwendungsweise des Wortes „warten“, schreibt Timo Reuter in seinem gut lesbaren gleichnamigen Buch, „ging aus der Vorstellung hervor, einem Kommenden entgegenzusehen.“ Wie lange man auf ihn wartete, spielte einst aber keine besondere Rolle. Weder beim „Warten« noch beim »Harren« ist im Grimm’schen Wörterbuch von Zeitverlust oder Zwang die Rede. „Heute ist das anders. Mit Hoffnung, dem gelassenen Verweilen oder einem heimeligen Warteort, mit dem Dienen und der pfleglichen Fürsorge hat das Warten kaum mehr etwas zu tun. Dafür aber mit verlorener Zeit.“
Während die (angeblich unwissende) Menschheit also früher unentwegt warten musste – bis der Regen fiel oder das Unwetter vorbei war –, dürfen wir heute erwarten, dass das Kind am 12. März geboren wird und das Erdklima um 1,5 Grad gesenkt wird. Das Geoengeneering verspricht, die Natur im großen Stil nach unseren Maßstäben umzuformen – zum Beispiel das Erdklima durch künstliche Aerosole in der Stratosphäre. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das schief geht.
Im Daoismus gibt es das weise Konzept des Wu Wei (Nicht-Erzwingen). Es bedeutet, im Einklang mit der natürlichen Ordnung zu handeln, statt gegen sie zu kämpfen. Wenn „Alles seine Zeit hat“, dann akzeptieren wir, dass das Leben von Rhythmen und Zyklen geprägt ist und sich nicht kontrollieren läßt. Es ist eine Einladung, Geduld zu üben, das Unveränderliche zu akzeptieren UND GLEICHZEITIG die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen.
Dazu gehört, in sich zu hören, was man wirklich will, was einem guttut und was nicht. Wir laufen zu sehr in den Tretmühlen, die andere für uns aufstellen und halten das für Freiheit. Welche Kontrollangst steckt hinter der Klimaangst und dem Geoengeneering? Welche fehlende Liebe kompensieren wir mit Konsum? Um wessen Anerkennung kämpfen wir, wenn wir im Büro Karriere machen? Wem wollen wir gefallen, wenn wir uns auf Instagram präsentieren? Wer warten kann, hat genug Zeit für sich selbst, fürs Handeln und fürs Loslassen, für den Genuss und für die Wehmut. Und der hat dann auch Zeit für den richtigen Augenblick.

