1958 erschien die „Vita Activa“ von Hannah Arendt zunächst unter dem Titel „The Human Conditon“ in den USA, wo Hannah Arendt seit ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten lebte. Das Buch stellt neben ihrer berühmten Studie „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ ihr zweites Hauptwerk da. Thema der „Vita Activa“ ist die amerikanische Massengesellschaft, die Arendt als eine Fortsetzung totaler Herrschaft mit friedlichen Mitteln beschreibt. Dies hat vor allem mit dem Siegeszug der Arbeit in der Moderne zu tun, dem Sieg des animal laborans. Im Ranking menschlicher Tätigkeiten steht die Arbeit bei Arendt an unterster Stelle. Umgangssprachliche Bezeichnungen wie Ackern, Plagen, Knechten, Malochen oder Schuften zeigen an, dass es sich dabei um ein Tun handelt, das aus der Not der Selbsterhaltung geboren ist und damit den Status tierischen Seins nicht übersteigt.
„Die Tätigkeit der Arbeit entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers, der in seinem spontanen Wachstum, Stoffwechsel und Verfall sich von Naturdingen nährt, welche die Arbeit erzeugt und zubereitet, um sie als die Lebensnotwendigkeiten dem lebendigen Organismus zuzuführen.“
„Das ‚recht und gut Leben‘ wie Aristoteles das Leben der Polis nannte, … war gut nur in dem Maße, indem es ihm gelungen war, der Lebensnotwendigkeit Herr zu werden, sich von Arbeit und Werk zu befreien …, so daß es der Knechtschaft durch den biologischen Lebensprozeß bis zu einem hohen Grade entronnen war.“ Hannah Arendt, Vita Activa, München 1981, S.37
Der durch Arbeit unterworfene Mensch ist ein animal laborans, ein Arbeitstier, das seine natürlichen Bedingungen, die Notwendigkeit der Produktion und Reproduktion, Arbeit und Verzehr des Erwirtschafteten zur Aufrechterhaltung des Lebens nicht überschreiten kann. Freiheit aber kann erst dort beginnen, wo Mühsal und Last der Arbeit enden. So sahen es bereits die Denker des antiken Griechenlands. Darauf zielt etwa Aristoteles´ Unterscheidung von bloßem Leben und vollkommenem Leben. In diesem Sinne ist Hannah Arendt immer Aristotelikerin geblieben, wenn sie schreibt:
„Das >recht und gut Leben< wie Aristoteles das Leben der Polis nannte, war daher nicht so sehr besser, sorgloser oder edler als das gewöhnliche Leben, als es von anderem Rang und anderer Qualität war. Es war gut nur in dem Maße, indem es ihm gelungen war, der Lebensnotwendigkeit Herr zu werden, sich von Arbeit und Werk zu befreien und den allen lebendigen Geschöpfen eingeborenen Lebenstrieb in gewissem Sinne zu überwinden, so daß es der Knechtschaft durch den biologischen Lebensprozeß bis zu einem hohen Grade entronnen war. (…) Keiner nur dem Zweck des Lebensunterhaltes und der Erhaltung des Lebensprozesses dienenden Tätigkeit war es gestattet, in dem politischen Raum zu erscheinen.“

Aus antiker Sicht kann die Aufwertung der Arbeit in der Neuzeit nur als ein grandioser Irrtum zur Abschaffung menschlicher Freiheit verstanden werden. Der springende Punkt für Arendt liegt darin, dass mit der Aufwertung der Arbeit der natürliche Kreislauf von Arbeit und Konsum zum höchsten Zweck und Ziel der Gesellschaft insgesamt erhoben wurde. Arendt verweist dazu auf Max Webers Analyse, der in seiner Religionssoziologie die protestantische Arbeitsmoral als wichtige Geburtshelferin des Kapitalismus beschrieben hatte. Nach Arendt gilt dies nicht nur für den Kapitalismus, sondern in gleichem Maße für die sozialistische Gesellschaft. Kapitalismus und Sozialismus stellen keine Kontrahenten dar, sondern zwei Seiten derselben Medaille. So ist die „Vita Activa“ über weite Strecken auch eine Auseinandersetzung mit dem Werk von Karl Marx. Insbesondere Marx´ Theorie der Arbeit hebe die antike Trennung von Natur und Politik auf, indem sie den Siegeszug des animal laborans ins Zentrum stelle.
„Wenn Marx die Arbeit als einen `Prozeß zwischen Mensch und Natur´ definiert, `worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert´, so daß sein Produkt `ein durch Formveränderung menschlichen Bedürfnissen angeeigneter Naturstoff´ ist, so ist die biologisch-physiologische Gebundenheit dieser Tätigkeit ebenso deutlich, wie daß Arbeiten und Konsumieren nur zwei verschiedene Formen oder Stadien in dem Kreislauf des biologischen Lebensprozesses sind.
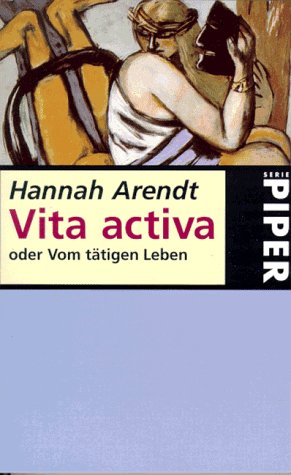
Bezogen auf die Entstehungszeit der „Vita Activa“ hieß das für Arendt. Sowohl der real existierende Sozialismus wie auch die amerikanische – als die am weitesten entwickelte westliche – Massengesellschaft stehen gleichermaßen für den Siegeszug des animal laborans und damit für den Verfall des Politischen in der Moderne. Auch die Steigerung der Produktivität durch Technik und die wachsende Teilhabe der Arbeitenden am Konsum bedeuten alles andere als einen Fortschritt, sondern heizen den haltlosen Kreislauf bloß weiter an. Der Prozess beschleunigter Vergesellschaftung pervertiert demnach das Politische, indem der öffentliche Raum von den Notwendigkeiten und Zwängen der gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsverhältnisse mehr und mehr vereinnahmt wird. Politik kommt dabei nur mehr eine dienende Funktion zu, die den gesellschaftlichen Prozess regulieren und verwalten soll. Damit aber sind die Belange der Reproduktion des Einzelnen sowie die der ganzen Gesellschaft zum Zweck von Politik überhaupt aufgestiegen und haben die Grenze von Politik und Gesellschaft zerstört.
Der philosophischen und christlichen Tradition zufolge stellt die Kontemplation, die Abkehr von der Welt und vollkommene Ruhe, die Bedingung dar, die ewige Wahrheit zu erkennen, bzw. Gott nahe zu sein. Arendt lehnt diese Tradition einer Vita Contemplativa nicht ab, sehr wohl aber die Hierarchisierung, die aus ihr erwachsen ist, demnach ein weltabgewandtes Leben allen Formen menschlicher Tätigkeit, inklusive der politischen, überlegen sein soll.
Denn so skeptisch Arendt den Aufstieg der Arbeit betrachtet, so hoch ist ihre Wertschätzung für das Handeln, das deshalb an oberster Stelle der Skala rangiert. Politisches Handeln unterscheidet sich vom Arbeiten insofern, als es eine von der unmittelbaren Lebensnotdurft und einem bestimmten Nutzen wie der reinen Selbsterhaltung befreite Tätigkeit ist. Der Sinn des politischen Handelns liegt daher als Vollzug dieser Freiheit in sich selber beschlossen. In diesem Sinn ist Arendts Beantwortung der Frage, was Politik sei, zu verstehen: „Der Sinn von Politik ist Freiheit.“
Hannah Arendt zählt zu den einflussreichsten politischen Denkern des 20. Jahrhunderts. Ihr geht es vor allem um politische Freiheit, die sich im „Zusammenwirken von Freien und Gleichen“ realisiert und nicht im Rückzug ins Private. In ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem sprach sie die unbequeme Wahrheit aus, dass normale Bürokraten zu Tätern werden können, ohne monströse Bösewichte zu sein. Damit lenkte sie den Blick auf die obrigkeitlichen Strukturen, die solche Verbrechen ermöglichen. „Vita activa“ ist eine wunderbare Absage an die moderne Arbeitsmoral und den Sinn, den die Arbeit uns allem anderen voran angeblich liefert. Die Freiheit beginnt erst dort, wo die Maloche aufhört. Wer seine Freiheit aber nur dazu nutzt, um faul in der Hängematte zu liegen, verfehlt sie. Der freie Bürger handelt politisch und stellt seine Kraft auch in den Dienst des Gemeinswohls.
Monika Boll ist eine deutsche Philosophin und Kuratorin. 2020 kruatierte sie die Ausstellung „Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“ für das Deutsche Historische Museum Berlin. Weitere Ausstellungsorte waren die Bundeskunsthalle Bonn und das Literaturhaus München. Begleitend zur Ausstellung erschien 2020 ein von Monika Boll konzipierter gleichnamiger Essayband im Piper Verlag.

