Dieses Buch zu lesen ist keine Zeitverschwendung, obwohl es über 800 Seiten dick ist, denn es ist ein Genuss: abwechslungsreich, spannend, klug und lehrreich, vor allem aber brillant geschrieben. Mit souveräner Fachkenntnis widmet sich Michaela Krützen einer hochaktuellen Frage in unserer hektischen Zeit: Vergeudet sein Leben, wer gammelt, faulenzt, fernsieht und nichts tut – oder tut dies nicht vielmehr derjenige, der rastlos arbeitet, konsumiert und im Hamsterrad läuft? Um zu ergründen, was Zeitverschwendung ist, zieht Krützen bekannte Figuren aus Literatur und Film heran, darunter Jeff Lebowski, den legendären Dude, Betty Draper, die eingesperrte Hausfrau aus Mad Men, oder Federico Fellinis ziellose Vitelloni. Krützen geht dabei vor wie ein Flaneur: langsames Fortschreiten, gelegentliches Innehalten, eine kleine Kehrtwende, gemächliches Schlendern. Gerade haben wir es uns im Bademantel des Dude Lebowski bequem gemacht, da bietet uns Krützen den Morgenmantel des Ilya Oblomow an, einem Meister des Nichtstuns, der den ganzen Tag im Bett liegt. Man wünscht sich beim Lesen, dass die Kapitel, jedes immerhin gut 80 Seiten lang, endlos weiter erzählen.
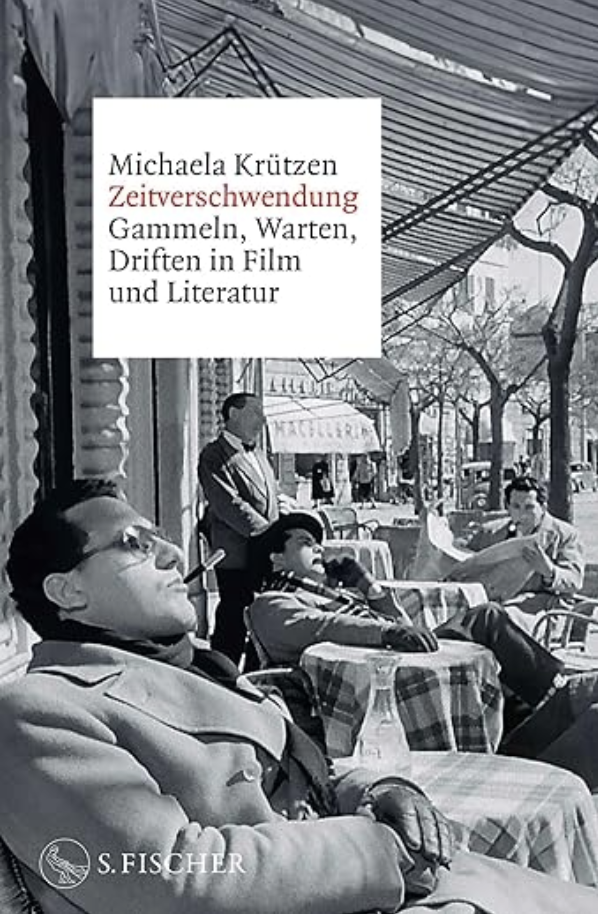
Beim Gang durch die zahlreichen Spielarten der Zeitverschwendung löst die eine Figur des Zeitverschwenders die andere ab, wobei Krützen stets kenntnisreiche und oft vergnügliche Bezüge zu anderen Romanfiguren und Filmen herstellt. Die Autorin wartet nicht am Anfang mit einer Definition von Zeitverschwendung auf und läßt anschließend ihre Kronzeugen nacheinander aufmarschieren. Sie erkundet vielmehr verschiedenste Protagonisten und prüft die Filmskripte und literarischen Texte anhand intellektueller Konzepte – etwa von Martin Heidegger, Max Weber oder Hartmut Rosa – auf ihre gedankliche Tiefe und oft auch auf ihre empirische Tragfähigkeit.
Man kann seine Zeit auf sehr unterschiedliche Weise verschwenden. Das Spektrum ist bunt und auch weltanschaulich heiß umkämpft. Der Gammler und der General dürften nicht gleicher Meinung sein, wie ein Tag zu verbringen sei. In American Psycho wendet Patrick Bateman unglaublich viel Zeit auf, um perfekt zu wohnen, auszusehen und zu speisen und mit Pierre Bourdieu wird uns erklärt, dass der Konsum von möglichst vielen teuren und bekannten Markenartikeln der Distinktion dient, der Markierung des sozialen Abstands zu den anderen. Vergeuden wir aber nicht unheimlich viel Lebenszeit mit Shopping, um Menschen zu imponieren, die uns eigentlich egal sind?
Um den Überflusskonsum von zigtausenden Produkten, die sich in unseren Schränken und Kellern sammeln zu finanzieren, müssen wir dementsprechend lang arbeiten, zumeist in Jobs, deren Bullshit-Anteil sehr hoch ist, was die drängende, schon von Bertram Russel gestellte Frage aufwirft, ob wir nicht zu viel arbeiten und zu wenig leben. Im Film „Die Lebenskünstler“ (1938) erkennt der arbeitswütige Millionär Anthony Kirby, dass „der Erwerb von Geld und immer mehr Geld“, im Grunde reine Verschwendung von Lebenszeit ist, das „gute Leben“ wird so verfehlt.
Man kann seine Zeit auf sehr unterschiedliche Weise verschwenden. Vor allem vergeuden wir viel Lebenszeit mit Überflusskonsum, um anderen zu imponieren, anstatt wirklich zu leben.
Derart lässt Krützen die Figuren und Themen fließend ineinander übergehen. Fast kommt man zum Schluß, dass es keine Tätigkeit gibt, die per se Zeitverschwendung ist. Sowohl die Zeit am Schreibtisch als auch die am Badestrand kann verschwendet sein. Aber gilt bei der Zeitverschwendung wirklich nur die postmoderne konstruktivistische Beliebigkeit? Krützen legt das nahe: „Niemand ist ein Zeitverschwender. Was als sinnvoll verbrachte Zeit gilt, wird immer wieder neu definiert und vom Umfeld zugeschrieben.“ Aber hätte man nicht immer schon, sowohl in der Antike als auch in der Moderne, jemandem, der mit 60 Jahren noch für den Olympiasieg trainiert, gesagt, dass dies vergebliche Mühe sei, weil das Ziel unerreichbar ist? Wenn alles gleichermaßen Zeitverschwendung sein kann, dann wird der Begriff so weit gefasst, dass er für alles gilt und letztlich für gar nichts mehr steht. Wenn jede Aktivität als potenziell sinnvoll oder sinnlos betrachtet werden kann, verliert der Begriff „Zeitverschwendung“ seine Aussagekraft.
Ein wirklich erklärendes Modell muss differenzieren können, um nützlich zu sein. Sonst wird es zu einer Tautologie, die zwar alles umfasst, aber nichts Spezifisches aussagt. Einem Bäcker mag die erste Stunde in der Backstube noch großes Vergnügen bereiten, die letzte aber eine Qual sein. Die subjektive Wahrnehmung von Zeit (schnell/langsam, langweilig/abwechslungsreich, angenehm/unangenehm) ist ein wichtiger Indikator für sinnvolle Zeitnutzung. Und hier gibt es essentialistische menschliche Gemeinsamkeiten: Egal, ob Aristoteles die Arbeit abwertete oder die Puritaner sie verherrlichten: Niemand hat sich je um den Job als Straßenarbeiter an der antiken Via Appia oder beim modernen Brenner Basistunnel gerissen. Solche Tätigkeiten sind knochenharte Maloche, die Menschen verrichten, weil sie das Geld brauchen – nicht, weil sie ihre Zeit unbedingt im Strassendreck verbringen wollen. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede in der Arbeitsmoral. In den USA etwa gilt es als „un-american“, nicht hart zu arbeiten – Amerikaner rackern mehr als Mexikaner. Doch wer Charles Bukowskis „Der Mann mit der Ledertasche“ gelesen hat, kennt die gewaltige Kluft zwischen der propagierten Arbeitsmoral und der realen Arbeitswelt auch in den USA.
Wenn alles als Zeitverschwendung gelten kann, verliert der Begriff letztlich seine Bedeutung.
Gesellschaftliche Bewertungen von Arbeit und Faulheit haben sich zwar gewandelt, aber eben nicht fundamental. Zu keiner Zeit wurde ein Familienvater geschätzt, der seine Familie hungern lässt, weil er statt zu arbeiten lieber die Zeit totschlägt. Wer sich der Arbeit verweigert, musste zum mindesten einen höheren Zweck geltend machen, sei es als Mönch, Asket, Adeliger oder Künstler, andernfalls verlor er jegliche gesellschaftliche Anerkennung. Krützen fragt selbst, ob die zahlreichen humorvollen Verfechter des Müßiggangs womöglich selber nicht so recht daran glauben, dass Arbeit reine Zeitverschwendung sei. Denn sie liefern keine Antwort darauf, wie sich ein auskömmliches Leben ohne Arbeit finanzieren ließe. Schließlich kommt sie zu dem Schluss, dass nur derjenige Arbeit als überflüssig betrachten kann, der wohlhabend genug ist, um nicht arbeiten zu müssen. Damit ist klar: Was Zeitverschwendung ist, ist gerade nicht beliebig. Es ist geradezu eine Konstante der Weltgeschichte, dass existenzsichernde Arbeit zu allen Zeiten als sinnvolle und notwendige Nutzung der Lebenszeit angesehen wurde und ein depravierendes Nichtstun als Verschwendung des Lebens. Keine Gesellschaft hat Arbeit grundsätzlich als Zeitverschwendung angesehen – auch nicht die adelsdominierte griechischen Polis. Dort wollten die freien Bürger aus nachvollziehbaren Gründen bestimmte Arbeiten nicht selbst verrichten und verachteten diejenigen, die die Drecksarbeit machten. Ein Muster, das sich übrigens bis heute fortsetzt: Am Prenzlauerberg etwa begegnet die woke Oberschicht der chinesischen Bügelfrau oder dem pakistanischen Lieferando-Fahrer mit ähnlicher Geringschätzung – viele haben keine sozialversicherungspflichtige Anstellung.
Sinnvolle Zeitnutzung erfordert die Balance zwischen genussvollen Momenten und anstrengenden Aktivitäten. Ein Leben voller unangenehmer Aktivitäten wäre sinnlos.
Zeitverschwendung tritt dann ein, wenn eine Tätigkeit zum Extrem wird, sei es beim Workaholic – wie Alfred Kinsey in T.C. Boyles „Dr. Sex“ – oder bei notorischen Nichtstuern wie Oblomow bei Gontscharow. Wir würden alle gern die ganze Zeit über glücklich und entspannt sein und im Flow von Erfolg zu Erfolg schreiten. Aber eine realistische Lebensbetrachtung zeigt, dass wir unsere Zeit nun mal nicht unentwegt angenehm verbringen können. Denn auch als unangenehm empfundene Zeit kann nicht-vergeudete Zeit sein, etwa wenn wir für das Ziel des sportlichen Erfolgs hart trainieren oder intensiv üben, um ein Musikinstrument zu beherrschen. Allerdings wäre ein ausschließlich aus unangenehmer Zeit bestehendes Leben sinnlos. Sinnvolle Zeitnutzung erfordert eine Balance zwischen angenehmen Erfahrungen und zielgerichteten, möglicherweise unangenehmen Aktivitäten. Eine sinnvolle Zeitnutzung setzt eine ausgewogene Mischung aus genussvollen Momenten und zielgerichteten, mitunter anstrengenden Aktivitäten voraus. Ebenso kann auch Vergnügen zur Zeitverschwendung werden – beispielsweise exzessiver Cannabiskonsum, der dazu führt, dass wir in einen Zustand endloser unbeteiligter Passivität abdriften. Hier besteht ein Ungleichgewicht zwischen angenehmen Erlebnissen und fordernden Aktivitäten.
Die meisten Menschen bewerten Fernsehen als unnütz vor der Glotze vergeudete Zeit, wie uns Krützen am Beispiel von Jean-Philippe Toussaints Selbsterfahrungsroman „Fernsehen“ und Hartmut Rosas Resonanztheorie näherbringt. Wenn es, wie der Konstruktivismus behauptet, nur eine Frage des Framings ist, wie jemand ein Ereignis bewertet, dann müsste eben auch die Einschätzung, ob das Fernsehen als Zeitverschwendung gilt, vollkommen subjektiv und vom individuellen Betrachter abhängig sei. Die Forschung über das Fernsehverhalten zeigt jedoch das Gegenteil: Aufgrund der Beschaffenheit unseres Erkenntnisapparats empfinden wir die schnelle Verfügbarkeit, die Kurzlebigkeit und die nur kurzfristige affektive Stimulation durch Fernsehinhalte als nicht erinnerungswürdig. Sie werden vom Kurzzeitgedächtnis gelöscht. Weil die Zeit vor dem Fernseher praktisch spurlos vergeht, bedauern wir die verlorene Zeit. Daraus lässt sich eine treffende Definition von Zeitverschwendung ableiten: Meide Zustände endloser unbeteiligter Passivität.

Zudem fällt auf, dass sich das Thema Zeitverschwendung seit jeher – und auch in Krützens Filmbeispielen – auffällig einseitig um die immergleichen Figuren rankt: Faulenzer, Taugenichtse, Müßiggänger, Herumtreiber, Nichtstuer, Aussteiger, aber eben nie um Tätigkeiten wie Kranke heilen, Kinder betreuen, Geburtshilfe leisten usw. Wie die von Krützen zahlreich beigebrachten literarischen Beispiele zeigen, gibt es zwar immer wieder ein Lob des Nichtstuns, aber es wird zumeist in einem heiteren, augenzwinkernden Ton vorgetragen. Der kauzige Diogenes und die Kyniker sind kein Gegenbeispiel. Diogenes war kein Philosoph des Nichtstuns, sondern der Autarkie. Weil alle Vergnügungen, alle Kultur, jede Arbeit und alle Sitten unsere Freiheit einschränken, zog er ein Leben in Bedürfnis- und Schamlosigkeit vor. Diogenes lebte bettelnd in einem Fass, damals wie heute warf man ihm vor, seine Talente und seine Lebenszeit zu verschwenden. Nichtstun als Lebensmaxime galt noch nie als sinnvoll verbrachte Zeit. Seit jeher warnten die Eltern ihre Töchter vor der Heirat unzuverlässiger Drückeberger.
Die Fülle der literarischen Beispiele für Nichtstuer gehört zu den großen Schätzen dieses Buches. Ihre Fixierung auf postmodernen Avantgardismus lässt Krützen dabei aber einen wichtigen Aspekt übersehen. Mit Recht stellt sie fest, dass sich „zahlreiche Zeitverschwender der ‚Reise des Helden‘ entziehen und damit zugleich dem klassischen Erzählschema eine Absage erteilen. Sie verändern sich nicht, weshalb sie sich nur bedingt als Hauptfiguren im klassischen Kino einsetzen lassen. Im Kino der Moderne aber können sie herumlungern, ohne befürchten zu müssen, auf eine Reise geschickt zu werden.“ Die Verweigerung der Heldenreise ist keineswegs modern, es gibt sie natürlich auch schon in der Antike. Bezeichnenderweise bei Narziss. Ovid erzählt, dass Narkissos an eine Quelle kommt, um seinen Durst zu stillen. Er hält das, was er im Wasser als Spiegelbild sieht für einen realen Körper und verliebt sich. Er bewundert das Haar, das Gesicht, den Hals und begehrt nichts ahnend nur sich selbst. Es geht ihm wie einer Katze, die in einen Spiegel blickt und nur eine andere Katze sieht. Narziss hat also keine Theory of Mind. Spiegelerkennen ist das Erkennungszeichen einer Theory of Mind. Kleinkinder erkennen sich erst nach dem 18. Lebensmonat im Spiegel und mit diesem Selbsterkennen fällt auch die Entstehung der Empathie zusammen, dem Miterleben der Psyche des anderen. Fehlende Empathie ist aber das entscheidende Kennzeichen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Genauer konnte es der Narziss-Mythos mit seinem Bild vom spiegelnden Wasser also nicht treffen. Die psychologische Beobachtungsgabe der Mythen ist immer wieder beeindruckend. Narziss hat aber auch etwas Kindhaftes, seine Ichentwicklung ist nicht abgeschlossen. Zumeist sind Narzissten Muttersöhnchen, denn sie verweigern sich der Entwicklung zum Erwachsenen. Krützen schildert das wunderbar bei den fünf jungen Männern, den „Vitelloni“ in Fellinis „Müßiggänger“. Sie albern herum wie Buben, flattern wie Schmetterlinge von einer Frau zur nächsten, warten darauf, dass etwas passiert. Sie haben keinen wirklich eigenen Willen, sondern lassen wie Kinder gern andere für sich entscheiden. Fausto bei Fellinis Vitelloni seinen Vater, der ihn sogar zur Heirat zwingt, Oblomow seine Haushälterin. Krützen zeigt hier an vielen Beispielen des modernen Romans (ungewollt) den Ewigkeitscharakter von psychologischen Profilen der Antike, die essentielle Motivdynamiken in der menschlichen Entwicklung darstellen. Der Held oder der Trickster sind solche Figuren, der narzisstische Muttersohn ist eine andere. Und er ist, so lautet die Erkenntnis aus Krützens umfangreicher Sammlung solcher Charaktere, ein zeitloser Typus des Zeitverschwenders, solange er den Entwicklungsschritt zum Erwachsenen nicht wagt. Und weil er das nicht tut, tritt er auch keine Reise an, sondern lungert herum.
Am Ende von Krützens Buch „Zeitverschwendung“ drängt sich die Frage auf, ob „Professor für Medienwissenschaft“ nicht der ideale Non-Bullshit-Job ist. Man sitzt auf dem Sofa, schaut eine Netflix Serie, knabbert Erdnüsse und wenn der Partner fragt, ob man denn auch bitte mal staubsaugen könnte, genügt ein lässiges: „Schatz, ich arbeite.“ Das ellenlange Endnotenverzeichnis legt allerdings den ernüchternden Verdacht nahe, dass auch Medienwissenschaftlerinnen gelegentlich harte Arbeit leisten müssen.
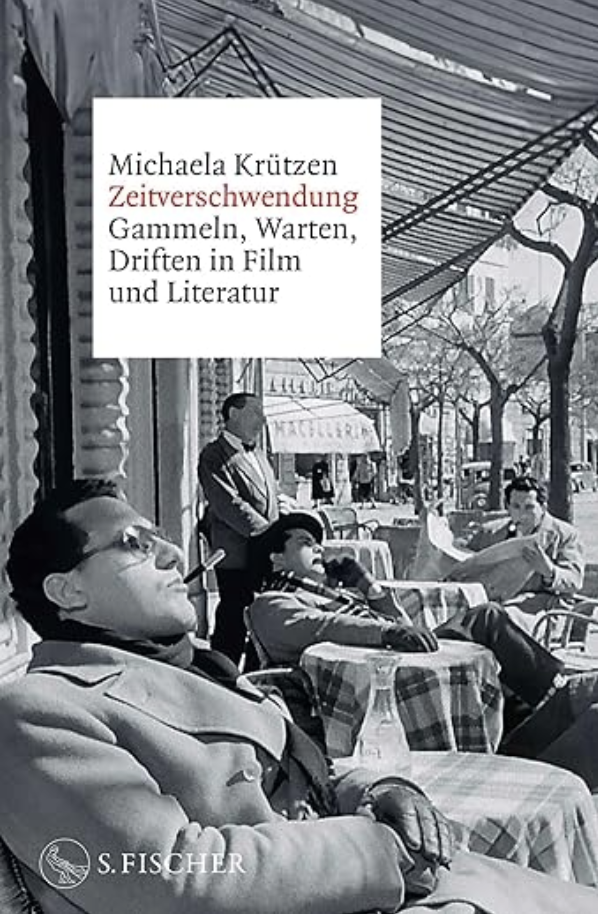
Zeitverschwendung: Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur
Autor: Michaela Krützen
Verlag: S. Fischer
958 Seiten
ISBN: 978-3103971729
Warum ist es was für Tachinieren?
„Der Tachinierer möchte Zeit im Überfluss haben, denn nur wer etwas im Übermaß besitzt, kann es verschwenderisch genießen. Hier erfährt er, wie in Romanen, Filmen und Serien über Zeitverwendung nachgedacht wurde.“

