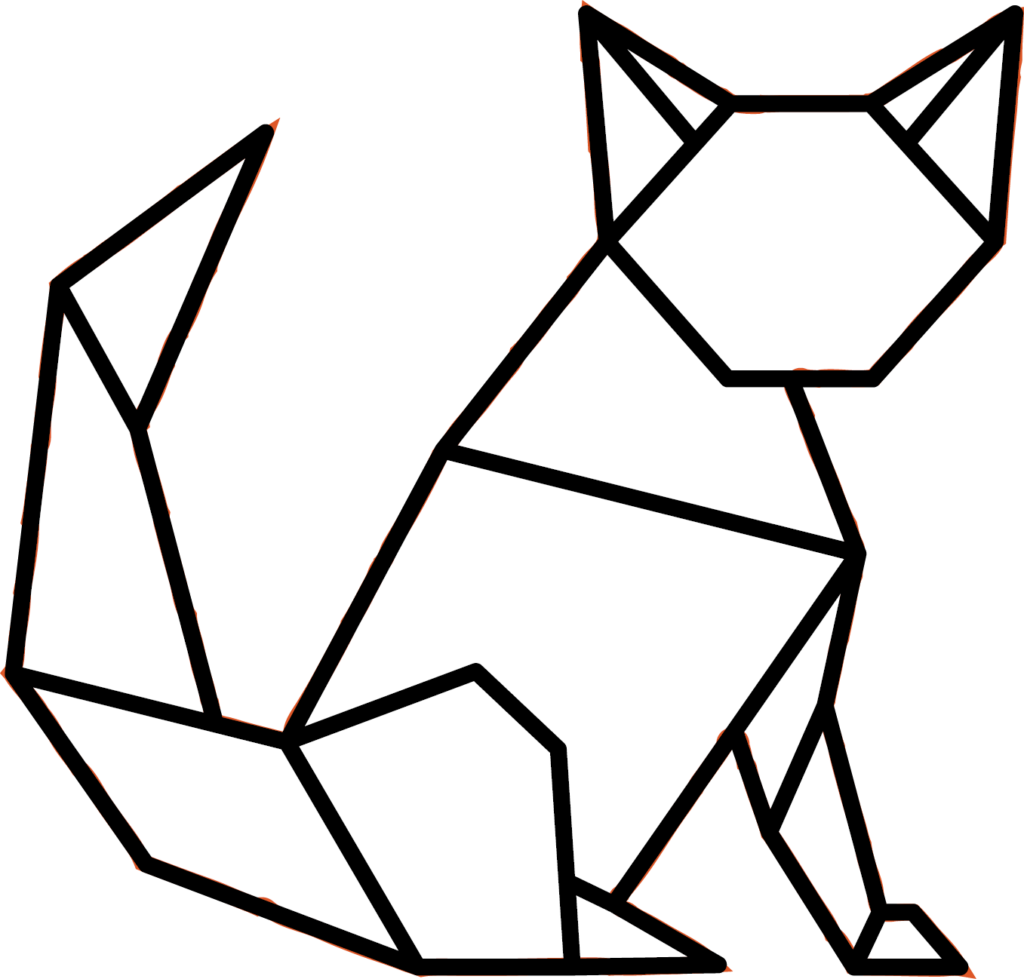Startseite » In der Hängematte
Wir haben das Warten verlernt
Der Advent, die Zeit des Wartens, ist zur hektischsten Zeit des Jahres geworden. Indem wir die Wartezeit totschlagen, schätzen wir den Weg und den Zauber des Moments nicht mehr und überschätzen das Ziel.
Frugaler Wohlstand
Unser extremer Umweltverbrauch ruiniert den Planeten. Doch wie kann eine mass-volle Wirtschaftsweise gelingen? Mit Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung und Entrümpelung
Cancelt Black Friday
Im Festkalender des Konsumkapitalismus ist der Black Friday ein hoher Feiertag. Wer schnell ist und clever, wird durch Schnäppchen gesegnet. Der Tachinierer umgeht dieses Konsumritual.
Wo bleibt die Muße?
Wenn wir in unserer Umgebung wieder genügend Orte vorfinden, die Muße und Besinnung zulassen, werden wir auch wieder mehr Zeit haben.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
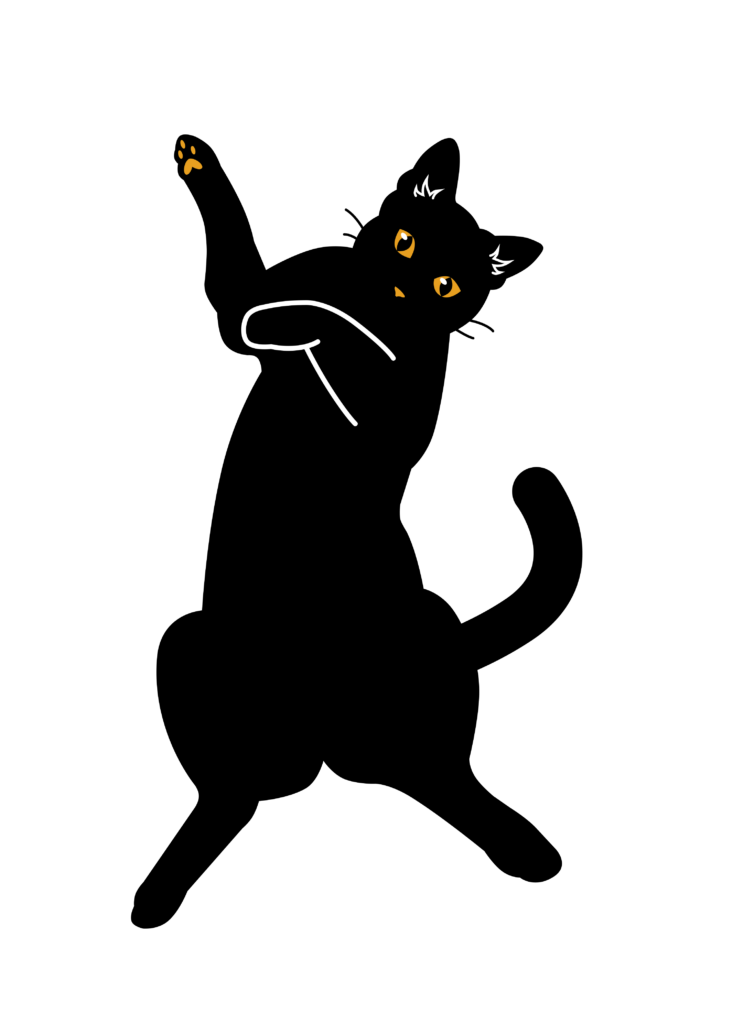
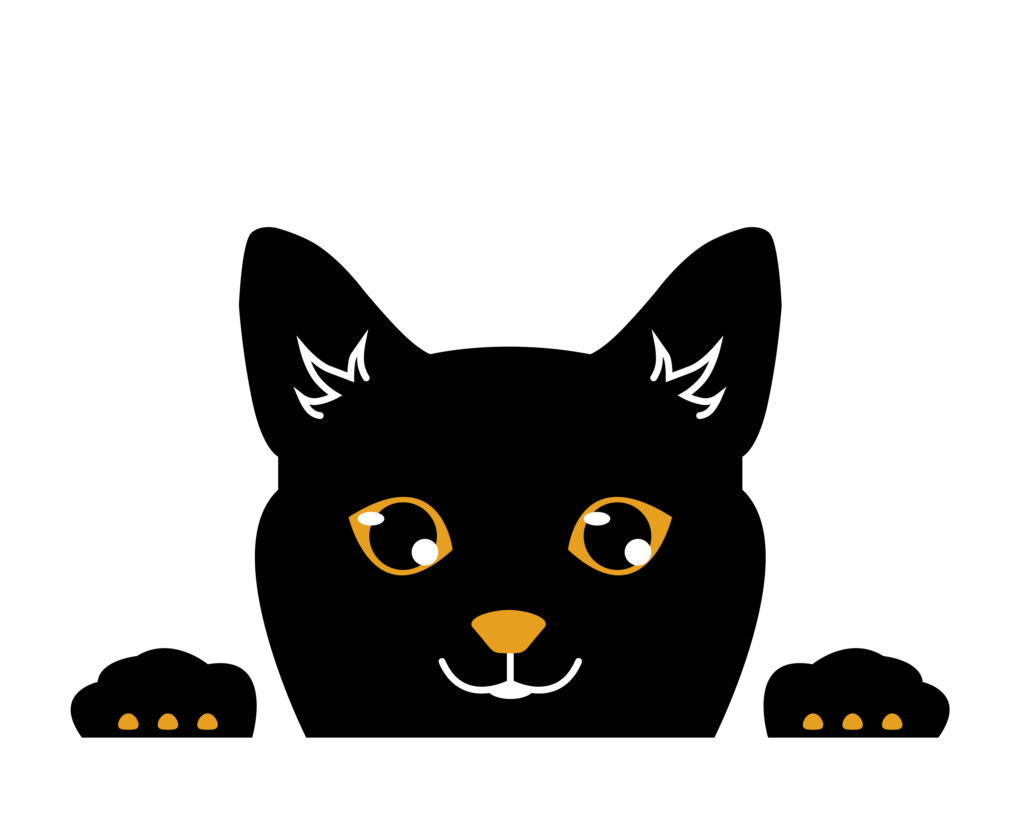
Fast Fashion – Wie Beschleunigung und Profitgier Mensch und Umwelt massiv schädigen
Früher lösten sich Modetrends alle zehn Jahre ab, bevor es Zeit wurde für etwas Neues. Heute jagt ein Modehype den nächsten. In den 50er Jahren gab es Petticoats und Stöckelschuhe, in den 60ern Miniröcke und Schlaghosen, in den 80ern Leggings. Das Modekarussell, von wenigen Großkonzernen wie Zara (Inditex), H&M oder Louis Vuitton (LVMH) angetrieben, beschleunigt sich rasant.
Wir kaufen im Schnitt doppelt so viele Kleidungsstücke pro Jahr, tragen diese allerdings nur noch halb so lang wie noch vor 15 Jahren. Modeshopping artet in Stress aus, weil viele Konsumenten wollen up to date sein wollen. Fast Fashion ist ein treffender Name für diese irre Geldmaschine, denn ein zentrales Element dieser Fehlentwicklung ist die Beschleunigung. „War die Lebensdauer eines Modetrends vor der Digitalisierung noch ein Jahrzehnt, so ist sie jetzt nur noch eine Saison“, schreibt Carl Tillessen in seinem erhellenden Sachbuch „Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen.“ Die Trenddauer hat sich um 95 Prozent verkürzt, von zehn Jahren auf ein halbes Jahr, dann muss ein neuer Look her.
War die Lebensdauer eines Modetrends vor der Digitalisierung noch ein Jahrzehnt, so ist sie jetzt nur noch eine Saison.
Profitieren tun davon nur wenige: Forbes zählt LVMH-Chef Bernard Arnault mit einem Privatvermögen von 189 Mrd Dollar zum aktuell reichsten Mann der Welt. Wenige Konzerne bestimmen darüber, was wir anziehen Als es noch Schneider gab, die von ihrer Arbeit leben konnten, und die meisten Frauen daheim schneiderten, konnte sich eine breite Kreativität entfalten. In der fast fashion Maschinerie sind davon nur noch ein paar Dutzend „Kreative“ übriggeblieben. Sie entscheiden auch darüber, aus welchen Materialien die Klamotten hergestellt werden. So enthalten mittlerweile zwei Drittel unserer Kleider Polyester. Die Kunstfaser setzt dreimal soviel CO2 frei wie Baumwolle und vermüllt Flüsse und Meere mit Millionen Tonnen an Mikroplastik. Der Konsument hat auf den Einsatz von Polyester ebenso wenig Einfluss wie auf Modefarben oder die Arbeitsbedingungen der Näherinnen. Die Herren des Verfahrens sind Milliardäre wie Arnault oder Amancio Ortega (Zara), den vor allem die kurzen Umschlagzeiten bei den neuesten Kollektionen reich gemacht haben. Dass Milliarden Textilien jedes Jahr weggeworfen werden und echtes Recycling der Kunstfasern kaum stattfindet, muss sie nicht kümmern, in die Nachhaltigkeitsindices schaffen sie es ohnehin.
Die Digitalisierung ist der technische Booster für diese Dynamik. Vom Schnitt bis zum fertigen Textil werden alle Produktionsschritte beschleunigt, über Instagram werden die Trendklamotten lanciert, Die kulturell-psychologische Dynamik kommt aus dem Konsum als Lebensinhalt: Wirtschaft und Gesellschaft brechen zusammen, wenn nicht immer mehr gekauft wird, und das Lebensglück hängt von der Menge an käuflichen Gütern ab. Shopping ist Selbstbelohnung und Selbstverwirklichung. In den 90er Jahren flog die Modewelt zweimal im Jahr zu den Messen nach Paris, Mailand oder London, wo die Trends ausgerufen wurden. Zeitschriften wie die Vogue, deren Chefredakteurin Anna Wintour (Der Teufel trägt Prada) zu den einflussreichsten Frauen der Branche zählt(e), bestimmten über den Erfolg von Marken und Designern. Im Printzeitalter dauerte es noch mehrere Jahre, bis sich ein neuer Stil weltweit etabliert hatte. Dafür konnte er sich dann aber durchschnittlich zehn Jahre lang halten. Die Vorabpräsentationen der kommenden Saison fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, kein Smartphone filmte heimlich mit, und alles war bis zum Saisonstart streng geheim.
Heute, im Zeitalter von Instagram, streamen die Marken ihre Fashion-Shows selbst ins Netz. Das Publikum darf dann die vorgelegten Fashion Modelle bewerten und der CEO bestimmt am Ende, was produziert wird. Weil der neue Look, anders als früher, schon kurz nach den Livestreams feststeht, können sich Fast-Fashion-Unternehmen wie Zara dranhängen und ihn massenkompatibel unters Volk bringen. Angeheuerte Mode-Influencerinnen sorgen für den Hype und dessen rasante Verbreitung. H&M, Zara & Co sind einerseits Profiteure des Modekarussells, denn je schneller die Leute ihre Klamotten als altmodisch aussortieren, desto mehr von der neusten Collection verkaufen sie. Als Beschleuniger des Karussells sind sie aber auch ihre eigenen Zuchtmeister: Ein Schritt zu langsam und schon greift die Konkurrenz den Umsatz ab. „Herrenlose Sklaverei“ nannte Max Weber diese Marktmechanismen, weil sie jedem lediglich die zweifelhafte „Freiheit“ lassen, sich ihnen widerstandslos anzupassen.
Für den Konsumenten gilt das genauso. Mode bezeichnet den „gerade vorherrschenden, bevorzugten Geschmack“, sie drückt eine Zugehörigkeit aus und entfaltet eine starke, wenn auch oft nur temporäre Konformität. Weder der Einzelhandel und erst recht nicht die Durchschnittsverbraucher können sich diesem, mit vielen Marketing-Milliarden erzeugten Druck entziehen. Das Modediktat der Großkonzerne ist übermächtig: Deshalb kann das heutige Modekarussell auch kein Ort des individuellen Lebensgefühls sein, das in der Werbung besungen wird. Dass diese Illusion geglaubt wird, ist die eigentlich große Leistung des Marketings. Es sagt uns: Du bist „in“. 99 Prozent kaufen Konfektionsware und halten sich dennoch für Individualisten. Wer heute in Bundfaltenhosen der 90er herumgeht, ist hoffnungslos antiquiert und wird auch so sozial abgestempelt: Du bist „out“. Das persönliche Lebensgefühl ist alles andere als frei, es muss sich modisch permanent anpassen, allein schon, weil frühere Modestile schneller denn je verschwinden und gar nicht mehr erhältlich sind. Nur die wenigsten dürften sich einen Maßschneider leisten können. Und so kommt es, dass der Großteil dessen, was getragen wird, den Geschmacks- und Preisvorgaben der Textilriesen folgt. Nur in diesen engen Grenzen läßt sich persönlicher Ausdruck und Geschmack realisieren.
Die Influencer erzeugen einen nie gekannten Konformitätsdruck, ganz im Interesse ihrer Auftraggeber. Wenn sich etwa Pia Wurtzbach ihren 12 Millionen Instagram Followern mit den neuesten Chelsea Boots von Vagabond zeigt, schnellt deren Absatz in die Höhe. Ihr Sauberimage als WWF und Save The Children Botschafterin färbt auf die Modeindustrie ab. Zudem dirigieren Likes und Shitstorms die User im Sinne des Mainstreams. Jeder glaubt, dass der eigene Look vor einem persönlichen Publikum (Follower) bestehen muss, das man ironischerweise nicht mal richtig persönlich kennt. Es hebt oder senkt den Daumen. Mit der Größe des Publikums wächst auch der Konformitätsdruck. Perfekter kann Anpassung nicht organisiert werden. „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“, erkannte schon der dänische Philosoph Søren Kierkegaard vor fast 200 Jahren. Wohlfühlen kann sich da keiner. Der Gruppendruck macht Stress, das Karussell dreht sich unbarmherzig.
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
Søren Kierkegaard
Social Media ist dabei ein wichtiger Beschleunigungsfaktor und trägt viel zur Billig- und Wegwerfunkultur der Generation Primak bei. Immer mit demselben Outfit auf Events zu erscheinen, geht nicht. Ein neuer Look muss her und bei Primak ist er eben billig und muss nur einmal halten. „In den sozialen Netzwerken ist die Lebensdauer eines Outfits nur noch ein Tag. So wird inzwischen jedes fünfte Kleidungsstück nur noch einmal oder maximal zweimal getragen,“ hat Tillessen beobachtet. Darunter leidet sogar die Recycling-Branche: „Die Textildiscounter und Fast-Fashion-Anbieter bringen in immer schnelleren Zyklen Mode in zunehmend schlechterer Qualität auf den Markt, die immer schneller entsorgt werden muss.“ Je mehr die Textilkonzerne über Nachhaltigkeit reden, desto größer wird der Berg an Altkleidern, die sich weder für den Second-Hand-Bereich noch für die Putzlappenherstellung oder die Faserrückgewinnung eignen. Nachhaltigkeit scheint sich zum Stichwort für (Selbst)täuschung zu entwickeln. Oder wie passt der fast fashion Trend zu den blumigen Nachhaltigkeitsprosa in Börse online: “Die kaufkräftigen Millennials haben einen gänzlich anderen Luxusbegriff als die Generationen vor ihnen. Grün statt Bling-Bling“. Die Zahlen sagen das genaue Gegenteil.
Wie lässt sich das Modekarussell stoppen, das mehr Unzufriedenheit schafft als Glücksmomente, das Näherinnen ausbeutet, das die Umwelt verschmutzt und uns im Grunde auch die kulturelle Selbstbestimmung darüber entzogen hat, wie wir uns kleiden? Man kann ganz aussteigen und wie ein Minimalist immer dasselbe Hemd anziehen. Aber wer will das schon? Wir sind soziale Wesen und leiden, wenn wir Außenseiter sind.
Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alles mitmachen müssen. Klar, wer sich etwa heute mit einer guten, alten haltbaren Jeans „selbstverwirklichen“ will, kann das gar nicht mehr, weil nur noch zerschlissene produziert werden. Modestile verschwinden über Nacht. Jeder muss aussortieren, und das immer schneller. Dennoch kann sich jeder wie beim slow food für den eigenen Konsum Zeit nehmen, Qualität kaufen. Die Großkonzerne und die Hypes meiden, soweit das möglich ist. Die Billigmarken der Fast Fashion sind die schlimmsten.Dem Dauerfeuer des Marketings entzieht man sich am besten durch Abschalten und durch Treue zum eigenen Stil. Wenn Bauchfrei Mode wird, muss ich das nicht tragen, wenn es mir nicht steht. Wichtig ist auch hier: Weniger ist mehr. Wie bei Biolebensmittel gibt es auch nachhaltigere Modelabel und Textilproduzenten, die es nicht so schlimm treiben.
Wir werden allerdings erst dann anders konsumieren, wenn die Gesellschaft den Konsum anders bewertet, wenn sie den Selbststeigerungsimperativ zurückweist. Denn mit dem Zwang, sich täglich neu erfinden zu müssen, sind immer neue Konsumausgaben verbunden. Da aber die Konzerne die Trends schaffen und die Konsumenten hochgradig steuern, wird sich wenig ändern, wenn sie die Macht behalten.
Was also tun? Die Zerschlagung der Textilkonzerne, die das Modekarussell organisieren, wäre ein wichtiger Schritt. Statt ein paar Dutzend Star-Designer gäbe es auf einmal Tausende kreative Schneider in mittelständischen Firmen. Statt wenige Mega-Events, von denen die Modehypes ausgehen, würde sich die Modewelt radikal regionalisieren. Influencerinnen und Celebrities hätten kaum Einfluss, es gäbe kein ausgefeiltes Lieferkettensystem, der Tross der Textilindustrie würde nicht mehr geschlossen vom Billig- zum Billigstlohnland weiterziehen und die Näherinnen ausbeuten. Um die Konzerne zu zerschlagen, müssten die USA mitspielen und die EU Kommission. Doch begleiten die weitere, tiefere Konzentration der Branche wohlwollend. Aber man könnte es den Konzernen schon schwerer machen, auch mit nationaler Kartell- und Umweltgesetzgebung, wenn man wollte. Für fast fashion steht die Ampel weiterhin auf grün.

Cancelt Black Friday
Im Festkalender des Konsumkapitalismus ist der Black Friday ein hoher Feiertag. Wer schnell ist und clever, wird durch Schnäppchen gesegnet. Der Tachinierer umgeht dieses Konsumritual.
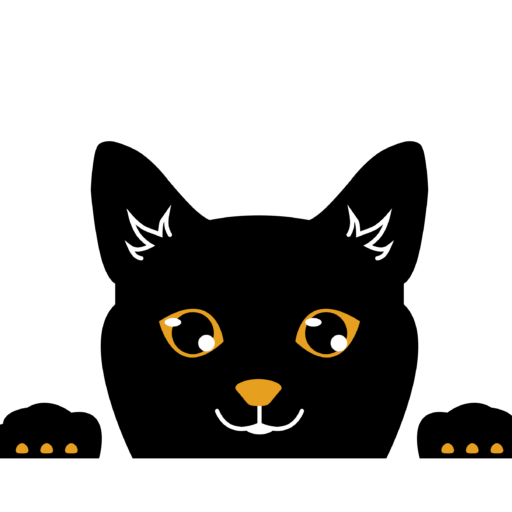
Wir haben das Warten verlernt
Die Wochen des Wartens auf Weihnachten gehören besonders mit Kindern zu den schönsten des Jahres. Kinder begeistern sich für die vielen Details des Festes: Das Plätzchenbacken, den Baum aussuchen und schmücken, die Adventskerzen anzünden, einen Teller für den Nikolaus vorbereiten, Weihnachtslieder singen. Kinder können noch warten, sie genießen die Vorfreude, auch wenn sie immer wieder ungeduldig fragen, wann denn nun endlich das Christkind kommt. Weihnachten ist Vorfreude pur, eben weil sie es kaum erwarten können. Wir Erwachsenen nehmen heute die Adventszeit als vorgezogene Weihnachtszeit und eilen von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Das nimmt nicht nur uns die Ruhe, sondern gibt auch den Kindern das falsche Signal: Wenn wir uns aber die Zeit nehmen, mit ihnen gemeinsam Gebäck zu backen, und der Weg das Ziel ist, wir also den Moment genießen, und weniger darauf schauen, ob alles perfekt ist, dann entsteht etwas Wertvolles. Selbstgebackene Plätzchen schmecken am besten und die leuchtenden Augen der Kinder machen uns das Herz voll.

Dass Maria auf ihr Jesuskind wartet, können Kinder gut nachvollziehen. Viele wünschen sich noch ein Geschwisterchen und können sich in das Warten und Hoffen hineinversetzen. Kinder haben häufig eine natürliche Offenheit für das Spirituelle. Weihnachten mit dem Jesuskind gibt ihnen das Gefühl, dass sie behütet sind, dass Gott und die Engel über sie wachen, und sie fühlen sich dadurch geliebt und angenommen. Dieses Vertrauen gibt ihnen Halt und vermittelt ihnen, dass sie in dieser Welt willkommen sind. Für dieses Gefühl nehmen sie das Warten gern in Kauf. Das ist zwar nicht die christliche, angstvolle Botschaft, die ja meint, die „Welt ging verloren“ und wir müssten erlöst werden. Der Kinderglaube hält es mehr mit der altbiblischen Botschaft der Liebe Gottes, die alle Religionen teilen.
Immerhin spiegelt das Warten auf die Parusie, auf die Wiederkehr Gottes, die im Advent symbolisch inszeniert wird, bis heute eine erwartungsfrohe Haltung wider: In den Psalmen heißt es: „Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten.“ Damals bedeutete Warten einerseits Unterordnung, doch gleichzeitig war es Ausdruck der Hoffnung auf das Gute, das aus einer höheren Macht hervorgehen sollte – ein Vertrauen darauf, dass nicht alles in der eigenen Kontrolle liegt. Demgegenüber steht der moderne Glaube an die unbegrenzte Machbarkeit: sei es in Form technischer Perfektion oder visionärer Ideen wie der „Singularität“, die eine Welt ohne Warten und Geduld verspricht.
Paradoxerweise führt dieser Fortschrittsglaube des „anything goes“ oft zu mehr Unglück als einst die mittelalterliche Vertröstung. Früher wartete man auf besseres Wetter, das Ende von Schmerzen oder das Schweigen der Waffen – ohne zu wissen, ob diese Hoffnungen je erfüllt würden. Heute hingegen leben wir in einer Zeit, in der jeder sein eigenes Glück täglich neu erschaffen soll. Wer nicht reich, glücklich, fit und frisch verliebt ist, gilt schnell als Versager. Und doch hoffen wir trotz aller technologischen Fortschritte immer noch wie früher – wenn auch auf einer anderen Ebene – auf Frieden, Glück und Heilung. Was hat sich im Kern wirklich verändert? Können wir heute tatsächlich selbst alles sofort zum Guten wenden? Dieselbe Regierung, die nicht einmal einen verfassungskonformen Haushalt zustande bringt, behauptet ernsthaft, das Weltklima regulieren zu können. Die Hybris, alles beherrschen zu können, durchzieht dabei sowohl die Politik als auch die Digitalkonzerne aus Kalifornien – und beide haben keine Zeit. Deren vollmundige Versprechen scheinen oft mehr Probleme zu schaffen als zu lösen – zuletzt verbot Australien Smartphones für Jugendliche wegen deren negativen Folgen für Geist und Psyche. Was uns vor die Frage stellt, ob wir wirklich so weit entfernt sind von den Hoffnungen und Ängsten früherer Zeiten – nur mit anderen Mitteln und einer ähnlichen Sehnsucht nach Erlösung. Wenn das so ist, was hat uns dann aber die rasende Ungeduld seit der Moderne gebracht?

Wir Erwachsenen haben heute das Warten verlernt. Es ist beinahe lustig, dass die Zeit des Wartens, der Advent, sich zur hektischsten Zeit des Jahres verwandelte, und die „Stille Nacht“ in eine „eilige Nacht“: „Alle rasen, keiner wacht / über Straßen im Lichtermeer / einkaufsgehetzt, die Tüten schwer“. Kinder brauchen die wahnsinnige Kommerzialisierung übrigens nicht, die wir inzwischen aus Weihnachten gemacht haben, auch wenn sie sich natürlich in erster Linie auf die Geschenke freuen. Sie waren früher mit viel weniger zufrieden und wären es heute genauso.
Der Zeitforscher Karlheinz Geißler erinnert daran, dass in fast allen Hochkulturen »Geduld, Gelassenheit, Beharrlichkeit und auch Langsamkeit, ein Zeichen der Würde, der Klugheit und der Selbstachtung« waren. Wenn das stimmt, dann haben wir heute generell an Würde, Klugheit und Selbstachtung verloren. Keine so gute Zeitdiagnose, oder?
Wir meinen, dass wir uns Warten nicht mehr leisten können. Wenn nicht sofort etwas gegen den Klimawandel, den Rückstand bei der Digitalisierung usw. – da läßt sich beliebig viel einsetzen – gemacht wird, dann geht die Welt unter. Fridays for Futures Frontfrau Greta musste ihren Twitterpost schon löschen, weil das Datum des von ihr vorhergesagten Weltuntergangs folgenlos verstrichen war, wie bei den Zeugen Jehovas.
Andererseits ist klar, dass Warten nicht bedeuten kann, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen und untätig zu bleiben. Schon im schicksalsgläubigeren und geduldigeren Mittelalter wussten die Menschen das. Ein Bauer wartete auf eine gute Ernte. Doch diese hängt nicht allein von seiner sorgfältigen und ehrlichen Arbeit ab. Sein Warten ist kein müßiges Abwarten, sondern aktives Handeln. Sein Warten ist Arbeit, und seine Arbeit ist Warten. Eine Ernte muss reifen, ein Kind muss erwachsen werden, und auch eine Entscheidung will wohlüberlegt sein. Alles hat seine Zeit.
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit …“
Dieser unzeitgemäße Spruch stammt aus dem Buch der Prediger (Kohelet) im Alten Testament. Dort heißt es in Kapitel 3 (1–8): „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, und Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit …“
Dieser Text beschreibt, dass es für alles eine passende Zeit gibt und dass der Mensch diese nicht vollständig kontrollieren kann. Die Natur folgt ihrem Lauf, das Leben bewegt sich in Zyklen, die Jahreszeiten wie die Konjunkturzyklen, und Zustände wechseln sich ab. Der Mensch tut gut daran, im Einklang mit der Natur zu leben. Die antiken Stoiker verbanden das Prinzip des „Alles hat seine Zeit“ mit der Gelassenheit (ataraxia). Wenn wir den Lauf der Natur durch Technik beschleunigen, kann das klappen, aber auch zu ungeahnten Nebenfolgen führen. Hat nicht die rasche Industrialisierung und der damit verbundene CO2-Ausstoß zu einer beschleunigten globalen Erwärmung geführt, und rennen wir jetzt nicht wie die Zauberlehrlinge der Entwicklung hinterher? Die Atomkraft versprach unermessliche Energie, aber unser Energiehunger ist größer als je zuvor und wir fürchten das nukleare Wettrüsten und den Atomkrieg. Was haben wir also unterm Strich gewonnen? Viele moderne Versprechen haben sich in ihr Gegenteil verkehrt: Statt mehr Zeit zu haben, hetzen wir, und statt selbstbestimmt über unsere Zeit zu verfügen, diktieren uns andere die Agenda. Wir haben das Warten verlernt. Indem wir die Wartezeit totschlagen, schlagen wir uns am Ende selber tot – wir schätzen den Weg nicht mehr, sondern überschätzen das Ziel (das vielleicht enttäuschender ist als der Weg dahin).
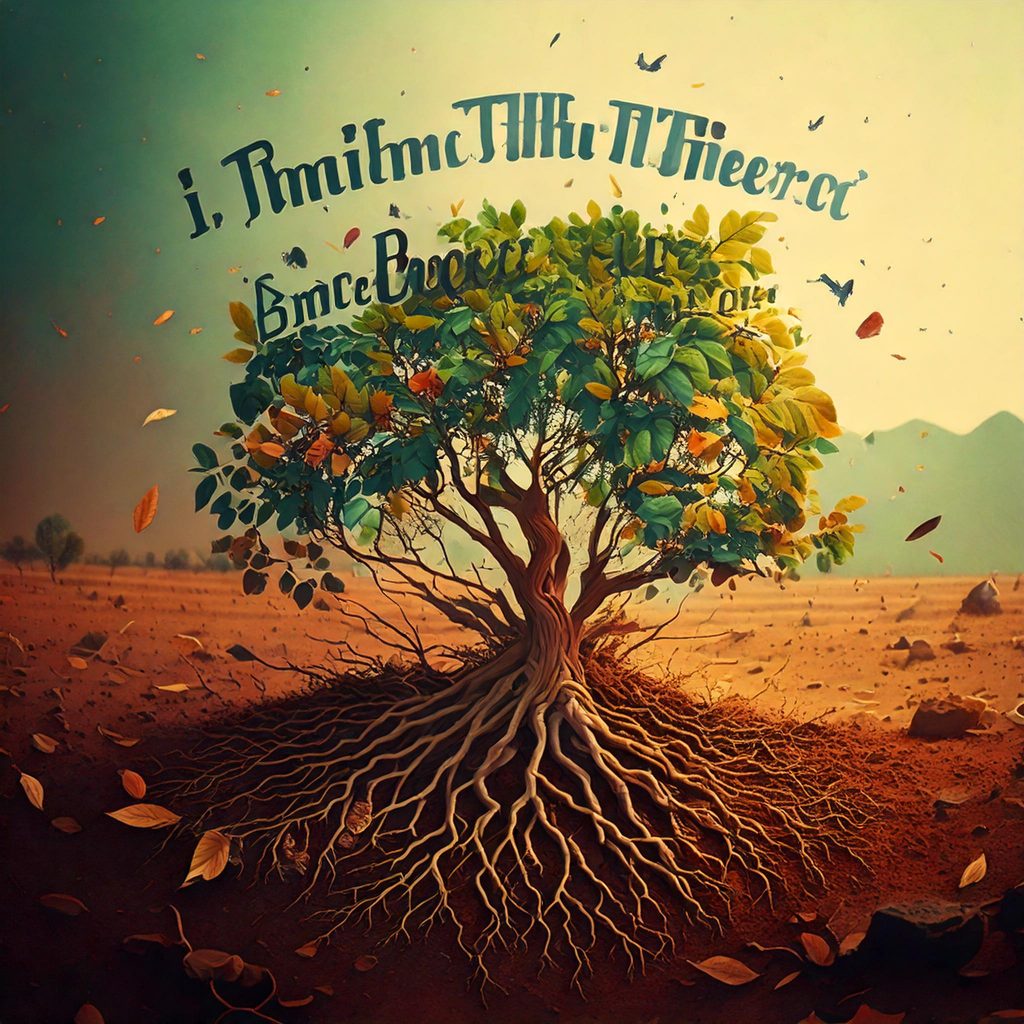
Die heutige Verwendungsweise des Wortes „warten“, schreibt Timo Reuter in seinem gut lesbaren gleichnamigen Buch, „ging aus der Vorstellung hervor, einem Kommenden entgegenzusehen.“ Wie lange man auf ihn wartete, spielte einst aber keine besondere Rolle. Weder beim „Warten« noch beim »Harren« ist im Grimm’schen Wörterbuch von Zeitverlust oder Zwang die Rede. „Heute ist das anders. Mit Hoffnung, dem gelassenen Verweilen oder einem heimeligen Warteort, mit dem Dienen und der pfleglichen Fürsorge hat das Warten kaum mehr etwas zu tun. Dafür aber mit verlorener Zeit.“
Während die (angeblich unwissende) Menschheit also früher unentwegt warten musste – bis der Regen fiel oder das Unwetter vorbei war –, dürfen wir heute erwarten, dass das Kind am 12. März geboren wird und das Erdklima um 1,5 Grad gesenkt wird. Das Geoengeneering verspricht, die Natur im großen Stil nach unseren Maßstäben umzuformen – zum Beispiel das Erdklima durch künstliche Aerosole in der Stratosphäre. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das schief geht.
Im Daoismus gibt es das weise Konzept des Wu Wei (Nicht-Erzwingen). Es bedeutet, im Einklang mit der natürlichen Ordnung zu handeln, statt gegen sie zu kämpfen. Wenn „Alles seine Zeit hat“, dann akzeptieren wir, dass das Leben von Rhythmen und Zyklen geprägt ist und sich nicht kontrollieren läßt. Es ist eine Einladung, Geduld zu üben, das Unveränderliche zu akzeptieren UND GLEICHZEITIG die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen.
Dazu gehört, in sich zu hören, was man wirklich will, was einem guttut und was nicht. Wir laufen zu sehr in den Tretmühlen, die andere für uns aufstellen und halten das für Freiheit. Welche Kontrollangst steckt hinter der Klimaangst und dem Geoengeneering? Welche fehlende Liebe kompensieren wir mit Konsum? Um wessen Anerkennung kämpfen wir, wenn wir im Büro Karriere machen? Wem wollen wir gefallen, wenn wir uns auf Instagram präsentieren? Wer warten kann, hat genug Zeit für sich selbst, fürs Handeln und fürs Loslassen, für den Genuss und für die Wehmut. Und der hat dann auch Zeit für den richtigen Augenblick.